Quanten sind kleine Sensibelchen. Sie lassen sich durch herumschwirrende Strahlung, leichte Temperaturschwankungen oder winzigste Staubteilchen völlig aus dem Konzept bringen, verlieren gar ihre „Quantigkeit“. In den meisten Fällen ist das ein riesiges Problem: Forscher:innen müssen enorm viel Arbeit investieren, um ihre Quantensysteme stabil zu halten. Eines der zentralen Probleme bei der Entwicklung des Quantencomputers ist, dass Qubits Fehler machen und die in ihnen gespeicherte Information vergessen.
Es gibt jedoch einen Teilbereich der Quantentechnologie, die diese scheinbare Schwäche der Quanten ausnutze: die Quantensensorik. Manchmal auch Quantenmetrologie genannt (von Metrologie, der Wissenschaft vom Messen, nicht Meteorologie, dem Wetter). Deren Grundidee ist es, die hohe Sensitivität von Quantenteilchen auszunutzen, um damit bestimmte Größen viel genauer zu messen als klassische Systeme das je könnten. Wie genau das funktioniert, will ich euch heute vorstellen! Freut euch auf einen Einblick in meine eigene Forschung.
Wie man etwas misst
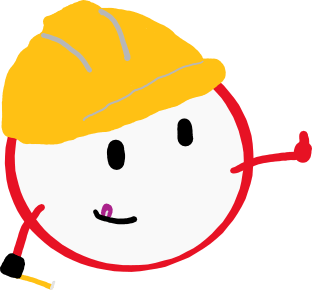
Dinge zu messen, ist tatsächlich eine ziemliche Kunst. Man muss sich überlegen, wie man überhaupt an die Größe rankommt, die man messen will. Der einfachste Fall ist ein direkter Vergleich. Will ich messen, wie groß ich bin, nehme ich einen Zollstock und vergleiche meine Größe mit den Strichen auf dem Stock – easy. Aber wie ist es etwa mit elektrischer Ladung? Wenn ich eine geladene Kugel neben eine andere geladene Kugel halte, sehe ich nicht, ob die Ladung die gleiche ist oder nicht.
Meistens misst man deshalb gar nicht die Größe, die man eigentlich messen will, sondern koppelt sie an eine andere Größe, die man leichter messen kann. Stellt euch vor, ihr wollt messen, wie hungrig meine Kaninchen sind. Hunger kann ich nicht sehen und die Kaninchen können es mir nicht sagen. Stattdessen setze ich sie vor je eine Schüssel mit Futter. Das eine Kaninchen frisst eine halbe Karotte, das andere eine ganze. Daraus kann ich schließen, dass ein Kaninchen hungriger war als das andere. Eigentlich habe ich aber nicht den Hunger gemessen, sondern die Anzahl der Karotten auf dem Teller. Die beiden Größen sind aber aneinandergekoppelt: Die Karotten wirken anziehend auf das hungrige Kaninchen.

Bei typischeren Messungen funktioniert es ganz genauso. Will ich etwa die Ladung von einem Stab messen, mach ich das mit einem Elektroskop. Das Elektroskop besteht aus einem leitenden Material. Nähre ich mich dem mit dem geladenen Stab, verschiebt die Ladung des Stabs die Ladung im Elektroskop und der Rahmen stößt einen beweglichen Zeiger ab. Wie weit der Zeiger ausschlägt, verrät mir, wie stark die Ladung auf dem Stab war. Eigentlich messe ich aber nicht die Ladung, sondern die Kraft, mit der sich gleichartige Ladungen abstoßen. Daraus kann ich die Ladung berechnen.

Viel hilft viel
Mit einer solchen Messung komm ich aber nur bedingt weit. Die Genauigkeit der Skala schränkt mich ein und verrät mir den Messwert nur mit einer bestimmten Präzision. Mit einem Zollstock kann ich nichts messen, was kleiner ist als die Abstände der Striche auf der Skala. Ich könnte die Skala feiner machen, das geht aber nicht immer und macht auch nicht immer Sinn.
Eine andere Methode ist, die Messung sehr oft zu wiederholen. Will ich zum Beispiel wissen, wie hungrig mein Kaninchen im Schnitt um 9 Uhr morgens ist, dann mache ich den Karotten-Test mehrere Tage hintereinander und berechne den Mittelwert der Karotten, die es jeden Morgen frisst.
Das Spannende: die Genauigkeit dieser Messung hängt davon ab, wie oft man die Messung wiederholt. Rechnet man das alles einmal durch, findet man heraus, dass die Genauigkeit mit der Wurzel der Zahl der Wiederholungen N skaliert:
![]()
Das klingt kompliziert, aber bedeutet einfach: Wenn ich meinen Messwert 10-mal genauer wissen will, muss ich 100-mal mehr messen. Will ich ihn 100-mal genauer wissen, muss ich 10.000-mal mehr messen. Das sind sehr viele Karotten!
Messungen mit Quantenpower
Mit Quantenphysik schafft man es aber, dieses Limit zu brechen! (Stellt euch hier bitte die „Eye of the tiger“ Musik vor.) Die Grundidee ist ganz ähnlich, wie bei normalen Messungen: Ich nehme einen Sensor, zum Beispiel ein Atom, und überlege mir einen Zustand, in dem das Teilchen ganz besonders sensibel auf die Größe reagiert, die ich messen will. Weil Quanten so sensibel sind, reagieren sie meist ziemlich stark auf schon kleine Änderungen der Messgröße. Genau das nutzt die Quantensensorik aus!
So einen Zustand zu finden, ist meist schon eine Herausforderung. Stellen wir uns vor, wir wollen ein elektrisches Feld messen, ganz ähnlich wie bei unserem Elektroskop von vorhin. Was ich möchte, ist eine winzige Testladung. Wenn ich die in das elektrische Feld setze, kann ich den Einfluss des Feldes auf die Miniladung messen – ich messe das elektrische Feld also auch hier nicht direkt, sondern die Kraft, die das Feld auf eine Miniladung auswirkt.
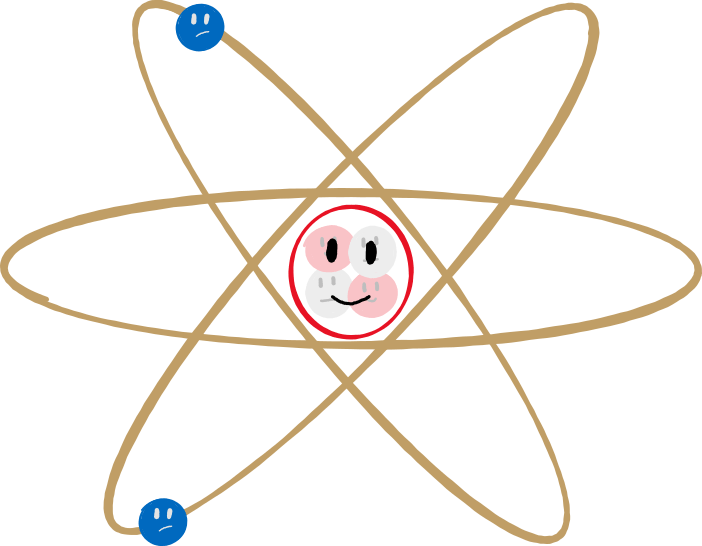
Wo aber finde ich so eine Miniladung? Im Atom! Normalerweise sind Atome ungeladen, es gibt also genauso viele positive (Protonen) wie negative (Elektronen) Ladungen. Was ich aber machen kann, ist, sie zu verschieben. Hätte ich alle positiven Ladungen auf einer Seite und alle negativen auf der anderen, hätte ich das elektrische Pendant zu einem Magneten: einen Dipol.

Spannend wird es, wenn wir den Dipol in ein elektrisches Feld setzen – also das Feld, das wir messen wollen! Zeigt der Dipol in die gleiche Richtung wie das Feld, wird seine Energie kleiner. Zeigen sie in unterschiedliche Richtungen, wird die Energie größer. Im Kern liegt dies auch daran, dass sich gleiche Ladungen abstoßen und gegensätzliche anziehen.

Habe ich also so einen Minidipol und setze ihn in ein elektrisches Feld, dann ist seine Energie ein kleines bisschen größer oder kleiner (je nach Orientierung) als ohne Feld. Und diese Energiedifferenz kann ich messen! Denn das Atom sammelt diese Energie auf wie Brotkrumen auf einem Pfad (oder Karotten im Gehege). Die Menge der Brotkrumen verrät mir, wie groß das Feld war.
(Wer genauer wissen will, wie man diese „Brotkrumen“ aufsammelt, kann in meinen Artikel zur Kernspinresonanz schauen: Genauso wie Magnetfelder rotierende Minimagnete beeinflussen, beeinflussen elektrische Felder Minidipole.)
Eine super Position
Ein bisschen habe ich damit schon gewonnen. Die Skala von diesem Atom-Sensor ist sehr viel kleiner und genauer als bei herkömmlichen Messgeräten. Aber: Der Fehler skaliert genauso wie vorher, also mit der Wurzel der Wiederholungen. Das nennt man „Standard Quantum Limit“. Der Name kann etwas verwirrend sein, weil hier tatsächlich noch gar keine richtige Quantenpower am Werk ist. Vielmehr bedeutet es, dass es das Beste ist, was man ohne Quantentricks machen kann.
In der Quantensensorik geht es aber um Quantentricks! Stellt euch wieder den Minidipol im elektrischen Feld vor. Je nach Ausrichtung ist eine Energie größer oder kleiner. Aber was, wenn ich zwei Minidipole überlagere – zwei Minidipole, die in zwei verschiedene Richtungen zeigen? Wenn der Dipol gleichzeitig nach oben und unten zeigt, ist die Energie dann größer und kleiner gleichzeitig?

Ganz genau! Das ist so, als würde mein Atom auf dem Brotkrumenpfad in zwei entgegengesetzte Richtungen gleichzeitig gehen. Ich sammel also viel mehr Brotkrumen auf und erhalte so viel mehr Informationen mit nur einer einzigen Messung!
Das Heisenberg-Limit
Rechnet man das ganze durch, bekommt man heraus, dass der Fehler der Messung mit der Zahl der Wiederholungen skaliert – ganz ohne Wurzel!
![]()
Das heißt: Will ich 100-mal besser sein, muss ich 100-mal mehr messen. Nicht 10.000-mal! Damit kann ich die Präzision sehr schnell verbessern! Diese Grenze heißt „Heisenberg-Limit“ – da das einzige, was meine Präzision noch beschränkt, die Heisenbergsche Unschärferelation ist. Es ist ein fundamentales Limit, gegeben durch das unvermeidliche Quantenrauschen, das verhindert, dass wir Größen beliebig genau kennen können.
Dies ist das Grundprinzip der Quantensensorik: mithilfe von Quanteneffekten wie der Superposition (oder auch Verschränkung) kann ich eine Größe viel präziser messen als ich es mit klassischen Methoden könnte. Wie viel präziser? In einem Experiment einer befreundeten Arbeitsgruppe [1] konnten sie Atome so präparieren, dass es ein Elektron in 0,7 mm Entfernung detektieren kann. Das Atom selbst war gut 260 nm groß. Das ist also 2650-mal weiter weg, als das Atom groß ist! Das ist so, als könnte ein Kaninchen eine Karotte in 500 Metern Entfernung riechen!
Das Beispiel, das ich oben durchgegangen bin, ist ein Beispiel aus meiner eigenen Forschung [2,3]. Meine Aufgabe war es, die Atome in diese überlagerten Mini-Dipol-Zustände zu bringen. Ich habe berechnet, mit was für Lichtpulsen wir sie beschießen müssen, damit ein langweiliges Atom im Grundzustand in diesen abgefahrenen Überlagerungszustand kommt. Und die Experimentalphysiker aus Paris, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben das im Experiment dann umgesetzt!
Darf ich vorstellen? Sabrina, Quanten-Dompteurin. Meine Aufgabe war es, Atome zu zähmen.
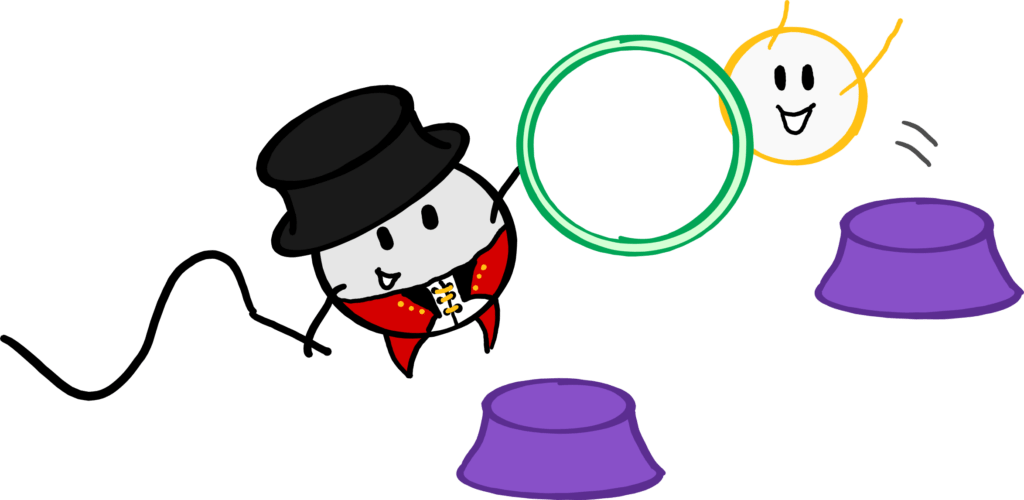
Wie genau ich Atome zähme, habe ich in meinem Science Slam „Wie ich Atome nach meiner Pfeife tanzen lasse“ erklärt. Schaut gern rein, falls ihr den noch nicht kennt. Alternativ wird vermutlich bald ein zweiter Teil kommen, in dem sich alles darum dreht (haha, Spoiler), Atome zu kontrollieren.
Gefällt dir, was du liest? Wenn du keinen Beitrag mehr verpassen willst, abonnier meinen Blog. Wenn du möchtest, kannst du mir auch hier einen Kaffee spendieren!
Quelle
[1] A. Facon, E.-K. Dietsche, D. Grosso, S. Haroche, J.-M. Raimond, M. Brune, and S. Gleyzes, A sensitive electrometer based on a Rydberg atom in a Schrödinger-cat state, Nature 535, 262 (2016)
[2] Sabrina Patsch, „Control of Rydberg atoms for quantum technologies“, Freie Universität Berlin. http://dx.doi.org/10.17169/refubium-34581
[3] A. Larrouy, S. Patsch, R. Richaud, J.-M. Raimond, M. Brune, C. Koch, S. Gleyzes (2020). Fast Navigation in a Large Hilbert Space Using Quantum Optimal Control. Physical Review X 10, 021058. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021058

Liebe Sabrina,
vielen Dank für diesen spannenden und gleichzeitig wunderbar verständlichen Einblick in die Quantensensorik! Es ist beeindruckend, wie du ein so komplexes Thema mit anschaulichen Bildern (ich werde das Kaninchen und die Karotten nicht mehr vergessen 😄) näherbringst.
Eine Frage hat sich mir beim Lesen gestellt: In der klassischen Elektrotechnik – z. B. bei der Messung mit einem Multimeter – greift man ja immer in die Schaltung ein. Dadurch verändert man mitunter die Größen, die man eigentlich messen will. Ist das bei quantenbasierten Messungen ähnlich? Also „stört“ die Messung das Quantensystem oder das Messobjekt selbst, und wenn ja: Wie geht man damit um?
Vielen Dank schon jetzt – und gerne mehr davon! 😊
Grüße
Tobias
Hallo Tobias,
vielen Dank, es freut mich, dass dir der Text gefallen hat!
Deine Frage ist berechtigt. Dazu gibt es zwei Antworten: Das Quantensystem wird durch eine Messung auf jeden Fall beeinflusst. Sprich ich habe ein Quantensystem in einem unbekannten Zustand, ich lese den Zustand aus und nach der Messung ist das Quantensystem in einem anderen Zustand als vorher. Darum geht es auch in meinen beiden Artikeln zum Beobachtereffekt (https://physicus-minimus.com/der-beobachtereffekt/ und https://physicus-minimus.com/quanta-are-watching-you-das-messproblem-in-der-quantenmechanik/).
Der zweite Teil ist die Frage, ob der Quantensensor die Größe beeinflusst, die ich messen will. Und in vielen Fällen ist die Antwort nein. Wenn ich ein Atom in ein elektrisches Feld setze, um das Feld zu messen, dann stört es das Feld nicht, ob da ein Atom drin rumfliegt oder nicht. Das elektrische Feld, was das Atom verursacht, ist im Vergleich einfach winzig. Das hängt aber von der Größe ab, die man messen will. Mir fällt allerdings gerade kein Beispiel ein, wo der Quantensensor tatsächlich einen Einfluss hätte.
Ich hoffe, das hat dir geholfen!
Viele Grüße
Sabrina
Hallo Sabrina,
vielen Dank für deine Antwort – das hat mir wirklich weitergeholfen!
Vor allem der Unterschied zwischen der Veränderung des Quantensystems selbst durch die Messung und dem möglichen Einfluss auf die gemessene Größe war für mich sehr hilfreich.
Dass der Sensor in vielen Fällen die Messgröße kaum beeinflusst, hätte ich so nicht erwartet.
Deinen Artikel zum Beobachtereffekt ziehe ich mir auf jeden Fall noch rein, klingt spannend – auch wenn beide Links irgendwie in denselben Zustand gefallen sind.
Aber wer weiß, vielleicht ist das schon der erste praktische Beweis für Superposition im Blogformat? 🙂
Viele Grüße
Tobias
Whoops, danke für den Hinweis, ich habe die Links angepasst 🙂
Viele Grüße
Sabrina